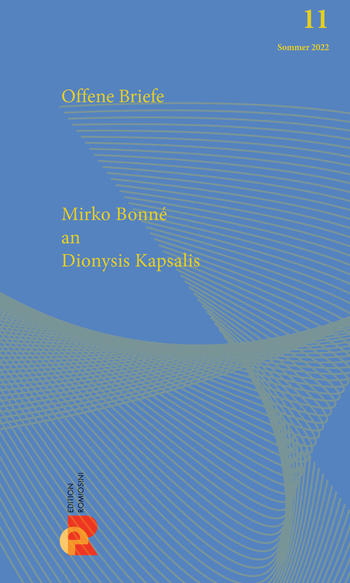#Lesenswert
22.03.2022
Ob Aufruf, Provokation oder Protest, ein offener Brief ist eine besondere Form des offenen Dialogs, ein Forum, ein Ansporn zum Austausch. Und dadurch ein willkommenes Format für die Edition Romiosini des CeMoG, die sich genau als das versteht: eine Agora, ein Ort des Dialogs und der Zirkulation von Ideen. Die Edition Romiosini hat bisher 11 offene Briefe deutsch- oder griechischsprachigen Autor*innen an Kolleg*innen jenseits ihrer Grenzen veröffentlicht.
Den 11. zweisprachigen "Offenen Brief" der Edition Romiosini schrieb Mirko Bonné an Dionysis Kapsalis. Mirko Bonné lebt als freier Schriftsteller in Hamburg und der Provence. Neben Übersetzungen von u. a. Conrad, Cummings, Dickinson, James, Keats und Yeats veröffentlichte er Gedichtbände, Romane, Erzählungen, Hörspiele sowie Aufsätze und Reisejournale.
Sein Blog »Das Gras« versammelt fortlaufende Betrachtungen unter mirko-bonne.de
Στη σειρά "Ανοιχτές Επιστολές" που κυκλοφορεί σε δίγλωσσες εκδόσεις από την Edition Romiosini δημοσιεύθηκε το κείμενο του ποιητή Mirko Bonné προς τον Διονύση Καψάλη.
Lieber Dionysis Kapsalis,
es ist ein Montagnachmittag in Südfrankreich, an dem ich meinen Brief an Sie beginne. Ich grüße Sie von Herzen.
Ich will Ihnen einiges zu Ihren Gedichten schreiben, wie ich sie verstehe, Ihnen jedoch auch von mir erzählen und die Gelegenheit nutzen, meinen Blick auf die Poesie in Worte zu fassen. Sie werden feststellen, dass dies alles andere als theoretisch vonstattengeht.
Leider sind wir einander bisher nicht begegnet. Ich kenne Sie einzig aus Ihren Gedichten und von dem Wenigen, das eine Vita zu verdeutlichen imstande ist. Kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurde ich vom Deutschen Übersetzerfonds gebeten, im Zuge eines Bode-Stipendiums Ihrem Übersetzer zur Seite zu stehen. Ich kenne Ihre Gedichte nicht im Original, sondern lese sie in den Übertragungen Torsten Israels, die mich stets aufs Neue in beglückendes Erstaunen versetzen.
Der montägliche Markt hier rührt allwöchentlich an meine Sicht auf die Zusammenhänge, die man Realität oder Wirklichkeit nennt, zumeist ohne die Begriffe voneinander abzugrenzen. Kaum ist alles wieder verschwunden, Stände und Feilbietende sowie all jene, die den Markt in Forcalquier besuchen, und schlendern meine Frau, die Kinder und ich daraufhin durch die Straßen, um uns vis-à-vis der Kirche vor unser Stammcafé zu setzen, dann geht mir auf diesem Weg jedes Mal die sicher geglaubte Orientierung verloren.
Dann beginne ich angesichts mit den Jahren vertraut gewordener Winkel, Ecken und Plätze daran zu zweifeln, dass sie identisch sind mit denen zur Marktzeit, wenn dort der Töpfer und sein Bruder stehen, in deren Keramiken die Mittagssonne blitzt, der ironische Marmeladenhändler aus L ’ Isle-sur-la-Sorgue oder der so betagte wie immerjunge Hippie mit dem Karton voll unverkäuflicher Supertramp-Platten.
Es gibt für mich zwei Forcalquiers – weshalb mich nie verwundert hat, dass der Name auf Provençalisch, in der auf Frédéric Mistral zurückgehenden graphie mistralienne, Fourcauquié geschrieben wird: Das eine existiert lediglich montags und nur bis zum Einsetzen der Nachmittagshitze, das andere für den Rest der Woche. Laufe ich durch Forcalquier oder Fourcauquié, dann denke ich oft an die kleine Stadt, die John Keats in der Ode on a Grecian Urn entwirft, ein auf dem Vasenrund dargestelltes verlassenes Städtchen, das er sich im Stil der Abbildungen auf der Sosibios-Vase vorstellte. Ich habe Keats übersetzt, in meinen Worten klingt die Passage so:
Welch kleine Stadt, am Fluß oder am Meer,
Mit friedlichem Kastell am Berg erbaut,
Verließ dies Volk zu dieser frommen Stund?
Und, Städtchen, deine Straßen bleiben leer
Für immer – keiner, der uns anvertraut,
Weshalb, kehrt je zurück und nennt den Grund.
Auch Keats ’ Stadt ist eine doppelte. Gemalt auf die Urne, ist sie real, doch sie behauptet ihre Wirklichkeit ebenso in der Imagination.
Beide Städtchen sind identisch und verschieden. Poesie, wie ich sie auch in Ihren Gedichten entdecke, erkundet die Grenzbereiche dieser Verschiedenartigkeit. Für mich erneuern sich die Trennlinien zwischen beiden Forcalquiers wöchentlich, genau wie meine – zum Glück – vergeblichen Rekonstruktionsversuche, zum Glück, weil ich ja nicht bloß existiere, sondern erst wirklich bin, wirklich da, wenn ich unter dem von der Sonne des Midi ausgeblichenen Baldachin des Café de L ’ hôtel de ville sitze und rauche, auf dem Smartphone die Katastrophen aktualisiere und die Leute betrachte.
Was ich in den Mienen und Gesten zu erkennen meine, haben Sie vor 40 Jahren, im Auftaktgedicht Ihres Bandes Erstes Buch, in eine Strophe gefasst:
Die Freunde aufgebrochen; wo sie auch gehen, öffnet sich
ein Garten namenloser Wunder, doch ich
blieb hier und harre der tückischen
Gaben von Zeit und Nacht, allein mit meiner
Leidenschaft fürs Wirkliche,
in dieser Pergola, meinem Gefängnis.
Erneut schweres Beben auf Haiti +++ Taliban überrollen Afghanistan +++ Delta-Variante entzündet vierte Pandemiewelle +++ Brände verheeren Griechenland +++ Antarktische Eisschmelze unabwendbar +++ Ist Polen noch eine Demokratie?
Beängstigend sind die Nachrichten dieses Sommers. So sehr Gründe und Ursachen für eine jede davon auf dem beruhen mögen, was man inzwischen fast unhinterfragt Fakten nennt, so wenig kann die globale, täglich 24-stündige Informationsschwemme, die unter vermeintlicher Einbeziehung aller Zweifel scheinbar alternativlos Fakten schafft, für eine erlebbare und somit lebenswerte Wirklichkeit sorgen. Das Empfinden von Sinnleere, Unwirklichkeit und Unbehaustheit ist den Leuten, denen man noch begegnet, immer häufiger ins Gesicht geschrieben, sobald ich das dystopische Display – meine Pergola, mein Gefängnis – in den Ruhezustand versetze.
Sofort ist sie dann zurück, die Wirklichkeit, deren Sprache die Fremdsprache Poesie ist und in der ich zu Hause bin wie bei meiner Frau. »Vom Feuer reden sie aber erkennen nicht / wie sich die Zeit verbraucht in ihren Augen«, heißt es in Ihrem »Ersten Buch«.
Wer will, mag Eskapismus darin ausmachen, wenn ich umso mehr Gedichte lese und schreibe, je grauenvollere Züge annimmt, was mich umgibt und kein Entrinnen kennt. Ich finde Trost im Lesen, seit ich sechzehn war, lausche der Musik des Atems, weiß wieder, es ist gut, am Leben und wach zu sein, schöpfe Mut, entsinne mich der Reichtümer, die jeder Augenblick bereithält.
Sobald ich unter dem Feigenbaum stehe, den der Großvater meiner Frau gepflanzt und großgezogen hat, und in seinem grünen Schatten lese, spüre ich den Unterschied zwischen sogenannter Realität und meiner Wirklichkeit sehr deutlich. Die Katastrophen verstummt, beginnen die Strophen zu klingen. Die Angstkruste platzt auf. Aus Verunsicherung wird wieder Neugier. Ich staune alles an – nicht zuletzt den Feigenbaum, la figuière, denn im Provençalischen sind die Bäume weiblich. In unserem lebt der Großvater weiter, der 100 Jahre alt wurde. Er pflanzte die Feigin findig – er war Ingenieur – in einen Bottich, den er durch ein Loch Woche für Woche tiefer absenkte – bis das Baum gewordene Bäumchen groß genug war, um eingegraben zu werden. Seither entwächst es dem Mausoleum seiner Wurzeln. Manche Äste strecken sich während eines Frühlings einen Meter in die Länge und suchen im Blättergewirr nach Wegen ans Sonnenlicht. Sie finden sie immer.
Unter dem Feigenbaum lese ich in diesem Feuersommer vor allem griechische Dichter. Die Brände in Griechenland, für die Nachrichtensendungen vergeblich Bilder zu finden versuchen, vergesse ich dabei nicht: »Unerforschliche Nacht, randlose Bitternis / Lider ohne Schlaf« lese ich bei Elytis, und die Zerstörung wird vorstellbar – ich erkenne sie wieder.
Unter den Feigen lesend, passiert es nicht selten, dass sich die abgeschottete Realität unvermittelt öffnet. Gestalten meiner Lektüren und alles fortfabulierenden Phantasie ziehen in sie ein. Kostas Mavrommatis aus Ihrem Gedicht »Allein kommt immer« begegne ich auf der Straße, die hinauf zur Kirche und weiter zur Colline führt, dem östlichsten Luberon-Ausläufer. Von den Kräuterhängen, den Olivenbaumgärten kommt er ins Dorf gestiefelt, auch bei Gluthitze eine Gauloise am Mund, im staubbedeckten Anzug – »ma clime mobile«, wie er hustend sagt. Gaston Mauromme-Matisse heißt er vielleicht.
In Jannis Ritsos’ Zeugenaussagen steht ein Gedicht, das unsere Nachbarin darstellen könnte: die Alte mit den fünf identisch wirkenden schwarzen Katzen, die abends zur Tränke geht, um dort auf der Bank sitzend ihren Mann abzupassen. Im Dorf, zwischen Café und Bar Tabac, spielt er Pétanque, so wie seit 70 Jahren jeden verfluchten Abend.
Wenn du zurückkommst, nehm ich dir auch
den Regenschutz ab. Mich reizen
die stehngebliebenen Tropfen. Mit zwei Fingern
brech ich vom warmen Brot einen Brocken, als
ob ich der Welt
in die Wange kneife. Denn, weißt du,
die Welt ist ein Duft warmen Brotes,
den ich bereiten muß
Der zentrale Vers könnte ebenso von Ihnen sein, auch wenn Sie ihn wohl im Jambus gehalten hätten: »… brech einen Brocken ich vom warmen Brot, / als ob der Welt ich in die Wange kneife.«
Um dieses In-die-Wange-Gekniffenwerden geht es. Ich schreibe täglich an diesem Brief, um eine Brücke zu schlagen. Nächstes Jahr werden Sie 70. Noch 2019 waren Sie neben Ihrer dichterischen Tätigkeit Leiter der Kulturstiftung der griechischen Nationalbank, ich weiß nicht, ob Sie diesen Job noch haben. Tant pis. Ihre Gedichte erzählen von Ihnen. Jedes philosophische Axiom müsse am Puls überprüft werden, sagt Keats, und für Gedichte gilt das in meinen Augen ebenso.
Inzwischen jubele ich über jedes Gedicht, das überhaupt noch entzifferbar ist. Lebendigkeit – für mich kein kontaminierter Begriff. Er meint etwas, das ich kenne, ein Glück, eine Sehnsucht, einen Mangel, und nur er drückt es aus. Ohne einen Begriff von Lebendigkeit gibt es keine, es sei denn, man ist es – lebendig wie nur Wenige, die Kinder, die Bäume, die Mäuse, die Wespen.
Mit Ihrem Band Frauentotenklagen – Heroinen des Sophokles hebt 2006 ein neuer Ton an, ein atemberaubend lebendiger. Die antiken Frauenfiguren erwachen, stehen auf von den Toten, blicken sich verwundert um. Sie erzählen, klagen in Wörtern und Sätzen von heute. So beweint die als phrygische Prinzessin verschleppte Tekmessa zwar den Tod ihres Peinigers und Geliebten, zeichnet aber genauso detailliert und einfühlsam Ajax’ Kriegerwahn nach.
Wer Ihre »Tekmessa« liest, lauscht einer Stimme aus der Tiefe der Zeit, die jeder Mensch als die seiner Mutter oder Großmutter in sich hört, und kommt schon deshalb nicht umhin, nach dem Wesen dieser, wie man heute sagt, toxischen, durch Gewalt und zerrüttender Leidenschaftlichkeit verunmöglichten Liebe zu fragen. Hat nur sie ihn oder hat Ajax auch Tekmessa geliebt?
Sie ist keine persona in Pounds oder Kavafis’ Sinn. Michael Hamburger schreibt in The Truth of Poetry, Kavafis’ empirisches Ich sei nur in dessen Verkleidungen gegenwärtig. Tekmessas Tiefenbohrung dagegen dient nicht der Suche nach dem Diamanten des Dichter-Ichs.
Vielmehr versucht Ihr Gedicht, ein zeitloses Gemüt zu umreißen und dessen Verwundungen nachzuvollziehen. Anti-Autofiktion. Erfasst werden soll ein unverstandenes anderes Ich. In seiner Dramatik noch verstörender ist das in »Iokaste«. Die Gattin des Ödipus, des Königs von Theben, erzählt hier vom Zusammenbruch ihres Lebens, als sie mitanhört, wie ein Bote Ödipus die Nachricht überbringt, er sei ein Findelkind. Wer die Mutter ihres Mannes ist, weiß nur Iokaste – sie selbst nämlich. Hat sie es vergessen, verdrängt oder verborgen?
Das Blut gefror mir in den Adern, als
ich hörte, was der Bote sprach: Es war
nicht Pólybos dein Vater, deine Mutter
auch nicht Merópe. Du warst ein Geschenk –
Geschenk – ein Scherz der ahnungslosen Götter
jedoch zum Leid der ahnungslosen Menschen.
Die Frau, die mir hier entgegentritt, ist an ihre Epoche nicht gebunden. Ihre Selbstzerfleischung ist zeitlos, wiewohl eine individuelle, nur ein Mal so erfahrene. Ein Ich auf schmerzerfüllter Zeitreise. Solchen Iokasten begegnet man in den lärmerfüllt alternden Städten der Provence täglich. Sie schleppen ihre Einkaufstaschen durch Manosque, sie regieren Marseille. Einer ihrer Söhne hat mir im TGV bei Avignon den Laptop gestohlen. Jede weiß, dass sie ewig ist.
Zugleich wuchtig und einfühlsam überträgt Torsten Israel den Atemtakt solcher unsterblichen Gestalten und damit den zwingenden Eindruck einer Zeitgebundenheit, die sich der Zeitlichkeit enthebt. Ja, Zeit scheint mir Ihr eigentliches Thema zu sein. Jedes Ihrer Gedichte lotet Dauer, Flüchtigkeit, Vergänglichkeit aus. Das Metrum, in dem Sie seit Jahrzehnten schreiben, öffnet Ihnen hierfür feste, in sich flexible Klangräume. Wordsworth, Coleridge, von Keats besonders Lamia und die Hyperion-Fragmente schreiben Sie fort.
Sobald ich in Das Geräusch der Zeit lese, klingt in meiner Erinnerung ein Gedicht auf, das ähnlich erfinderisch Freiräume des Blankverses nutzt. Ezra Pounds »Portrait d ’ une femme« setzt sich gegen das Vergänglichkeitsverhängnis zur Wehr:
No! there is nothing! In the whole and all,
Nothing that’s quite your own.
Yet this is you.
Diese Pointe elektrisiert mich, seit ich als Abiturient erstmals Pound las. Mit seinen raffinierten, vom Zweifel getragenen Aufzählungen und dem so emphatischen wie empathischen Sound zählt »Portrait d ’ une femme« auch deshalb zu meinen Herzgedichten, weil ich mir seinerzeit auf Spaziergängen das Gedicht wieder und wieder hersagte. Alles, was ich wahrnahm, floss in meine geplante Fortschreibung ein, eine zugleich äußere und innere Inventur, die ich erst 2018 abschloss:
Im müden Fließen von mal Licht, mal Tiefe,
nein, da war nichts, in diesem Kehricht
nichts, was ganz dein war.
Aber das warst du.
Aus dem »Laub der Dinge«, wie es in meinem Gedicht »Portrait d’une baraque« heißt, lässt sich kein Ganzes neu oder wieder zusammensetzen. Jedoch bietet sich im Annehmen von Vielfältigkeit und Versprengung die Möglichkeit, in beidem – Akzeptanz und Diversität – ein ansprechbares Du auszumachen. Die Vergänglichkeit verliert im auto-kreativen Akt ihren Schrecken. En passant wie stets, wenn er sich poetologisch äußerte, schrieb John Keats in einem Brief: »That which is creative, must create itself.«
Dass Sie Ihre Zeitmaschine aus Blankversen nicht deshalb ersonnen haben, um Ihr Ich zu verewigen, zeigt exemplarisch Ihr vielleicht erstaunlichstes Gedicht.
»Die Flip-Flops« kehrt die aus der Tiefe zur Oberfläche führende Bewegung um. Die Angerufene, Kitty, ist zwar Erinnerung. Im immergleichen Zeigertakt des Jambus wird ihr aber eine quasi göttliche Befähigung zugesprochen, nämlich, ganz als wäre sie »unsterblich wider Willen«, die Zeit regieren zu können. An Kitty, niemanden sonst, will das Gedicht erinnern. Aus guten Gründen. »Alle Menschen sind der Liebe wert«, sagt Georg Trakl, und wer, den man ernst nehmen könnte, würde etwas anderes behaupten.
Die Augen (grün, will es mir scheinen) hebe
vom Dunkel dieser Welt, und so als würdest
du selbst die Zeit regieren, so als seiest
unsterblich wider Willen du geworden
auf deine Fingerspitzen träufele Licht
und, Kitty, segne mich, und segne mich.
Es ist verwunderlich, genauso aber konsequent und in sich schlüssig, dass »Das Geräusch der Zeit« nur ein Jahr nach den »Totenfrauenklagen« erschien. Setting, Figuren und Ton sind heutiger, Metrum und Takt dieselben. Das Titelgedicht kommt unmittelbar auf den Zusammenhang von Zeit und Versfuß zu sprechen.
Von den alten Griechen wird gesagt:
makrós: lang – ánaríthmytós: unzählbar
oder auch pándamátor: Allbeherrscher.
Wie sonst auch nennen die Gewalt die dich
schnell wie das Leben tötet, die verhöhnt
die Poesie im Fluidum der Tage
die zarte Widersetzlichkeit der Stunde.
Als habe der Jambenzeiger das Zifferblatt des Gedichts einmal umrundet, greift die abschließende Strophe das refrainartig wiederholte Motiv, in dem jede Sekunde Laut wird, erneut auf: »Makrós … ánaríthmytós … pándamátor«. Der letzte Vers klingt nur beim ersten Lesen desillusioniert, bloß scheinbar ergibt er sich dem Fatum, dem alles Chronische und Chronologische unterliegt: »Jenseits der Zeit ist alles Dunkelheit.«
Vielmehr weist er gelassen, so in sich ruhend wie rebellisch in dieselbe Richtung wie Jannis Ritsos’ berühmter »Vers«:
Ein voller Geschmack vom Ende geht dem Gedicht voran. Anfang.
Formal mag Ihre Gedichte mit Ritsos’ wenig verbinden. Wo seine aus Erlebtem archaisch, ja mythisch anmutende Symbole formen, die irritierend surreale Elemente aufweisen, machen Ihre Imaginiertes erlebbar. Ritsos will Emotionen wachrufen. Ihre Dichtung ist Musik aus Empfindung, Bedeutung, Erinnerung, lustvolles, verspieltes Zeigertakt-Echo oder, wie es Ritsos in »Antikes Theater« ausdrückt, »griechisches Echo, das nicht nachahmt, nicht wiederholt, / sondern fortsetzt auf überzähliger Höhe / den ewigen Lustschrei des Dithyrambus.«
Mitte August kündigen sich die Hochsommergewitter an. Von Digne ziehen sie die Durance hinab Richtung Aix und Marseille, Fluss-in-der-Luft, wenn es schon keinen Fluss mehr gibt – die Durance ist so gut wie vertrocknet, Steinbett, Kieselstrom.
Seltsam, wie frisch die Nachmittage mit einem Mal sind. Der Mistral bläst alles zum versteinerten Fluss hinunter, was keinen Halt mehr hat, Herbstlaub, Kehricht, Fetzen. Der Windname ist derselbe wie der des Literaturnobelpreisträgers von 1904. Plötzlich duftet das ganze Dorf nach Thymian, wird frigoulet – nach Mistral ein Ort, an dem in Hülle und Fülle Thymian wächst.
Sobald der Mistral weht, macht sich eine große, lärmend schwatzende Dohlenart über den Feigenbaum her. Die durchs Geäst äugenden Vögel beanspruchen alles reife Obst für sich. So viele, so laut sind sie, dass vor ihrem Flattern und Plappern Wespen, Eidechsen, Hornissen und Geckos Reißaus nehmen.
Nur die Ameisen bleiben. Schwarz, scheu und emsig klettern sie vom Wurzelwerk den Feigenbaumstamm empor und bahnen sich über Äste, Gerätehausdach und ein Mäuerchen den Weg hinauf zum First, wo sich ihre Königin verbirgt. Sie kennen das Haus so gut wie wir. Sie bevölkern es so, wie sich die Familienerzählungen mit ihnen beschäftigen. Für sie gilt dasselbe wie für Elytis’ Eidechsen: »die Eidechsen auf den Denkmälern wissen weder von / Bildhauern noch von Architekten«.
Wissen sie, dass es Menschen gibt? Sind wir ihnen gleichgültig, oder nehmen sie uns hin wie die Augustgewitter? Existieren wir jenseits von ihnen, so wie für uns dasjenige, das alles was wir kennen, enthält, alle Sterne, alle Dinge?
Neben der Lebendigkeit Ihrer metrischen Fügungen – ein Lebensjambus –, und der plastischen Anschaulichkeit Ihrer Erinnerungen – besonders jener an Ihre Kindheit –, empfinde ich als das Elektrisierendste in Ihren Gedichten, dass sie der Benennung und Hinterfragung sogenannter letzter Dinge nicht ausweichen. Wer traut sich das noch zu in unserer aufs Neue mit Beschränkungen und Tabus so vernagelten Zeit? Immer wieder finden Sie zu einem warmen Ton, der unmittelbar anspricht, und lassen dem Gedicht Zeit, sich zu entfalten, billigen ihm die Muße zu, die uns heute in den meisten Zusammenhängen, gerade den sprachlichen, entgegen aller Beteuerungen abhandengekommen ist.
In meinen Augen entstand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein einziges Gedicht, das in möglichst einfache Worte und einen uns Menschen angemessen zugewandten Ton zu fassen vermocht hat, was ich unter »letzten Dingen« verstehe: einen poetischen Leitfaden, eine unabdingbar würdevolle, sich unter keinen Gott, keine Schöpfung, kein System beugende und dennoch die bittersten Lebensumstände annehmende, in sich aufnehmende Haltung.
Ich spreche von Ezra Pounds »Canto LXXXI«:
What thou lovest well remains,
the rest is dross
What thou lov ’ st well shall not be reft from thee
What thou lov ’ st well is thy true heritage
In Ihren Gedichtbänden »Schwarzes Gittertor« und »Aufzeichnungen zur Welt der Musik« finden Sie zu einem ähnlich gelassenen Ernst. Keine Stunde von hier, in Lourmarin, drückte Albert Camus diese Haltung in einem von der mediterranen Sonne geprägten Bild aus, als er wenige Wochen vor seinem Unfalltod in sein Tagebuch sein einziges Gedicht schrieb. In »An Nemesis« heißt es: »Wahrheit lügt. Offenheit verhehlt. Verbirg dich im Licht.«
Ich lese diese Nemesishaltung eines ausgleichenden Gerechtigkeitssinns etwa in Ihrem Gedicht »Grabschrift«, dessen drei Strophen klanglich-semantische Permutationen darstellen:
Es sammelt hin und wieder sich das Schweigen
und wird zu einem festen Kern (…)
Es sammelt hin und wieder sich das Schweigen
ein blauer Eindruck, ein Erstrahlen (…)
Es sammelt hin und wieder sich das Schweigen
ein tiefes Wellenspiel, ein neues Beben (…)
Die Kinder schlafen unterm Dach. Meine Frau sitzt im Kaminzimmer auf dem Fußboden und sieht Fotoalben durch, ruft mich zu sich, sobald ihr ein Bild vor Augen kommt, das ihr neu ist, eines von der Terrasse, als es die Feigin nicht gab, vom Baden in der Durance, als dort noch keine Autobahn entlangführte, von dem Großvater, der 27 Jahre lang als Witwer allein hier im Haus lebte. »Qu ’ est-ce qu ’ il a fait pendant toutes ces années?«, fragt sie mich mit demselben Blick wie das Mädchen auf den Fotos.
Ob es dunkelt
ob es tagt
immer weiß bleibt
der Jasmin.
Auf dem Küchentisch lege ich neben Giorgos Seferis’ Gedicht das mir liebste von Ihnen, »Schwarzes Gittertor«, über das ich seinerzeit in Ihre Dichtung hineingeklettert bin. Obwohl »Der Jasmin« nur einen Bruchteil so lang ist, drücken beide Gedichte für mich dasselbe aus.
An Torsten Israel schrieb ich kurz vor Corona: »Kapsalis lässt mich ohne Wenn und Aber überzeugt sein von der Richtigkeit der Annahme Brodskys, einzig die Poesie werde die Welt retten. In Ihren Übersetzungen lese ich Beispiele dafür, dass es für diese Rettung – die eine alltägliche ist – noch nicht mal der Gedichte bedarf.«
Camus notierte 1958 in sein Griechenland-Tagebuch: »Mit der Wirklichkeit nicht mogeln. Somit seine Originalität und Ohnmacht akzeptieren. Dieser Originalität gemäß bis zu dieser Ohnmacht leben. Im Mittelpunkt die Schöpfung mit den immensen Kräften des endlich respektierten Menschen.«
Auf Camus ’ Fährte kam ich 2014 nach Symi. Dort sah ich:
in der Oberstadt des Fischerhafens
ein Haus, dessen Dach, Innenwände und Fuß-
böden hat ein das aufgegebene Gemäuer
nach und nach einnehmender Baum
gesprengt.
Wild, tief dunkelgrün,
wächst die Feige auf Unrat und Müll,
hineingeworfen zu den Fenster-
löchern – wie in einen
Schacht, in dem
Verfallenmüssen und
Leere zusammenfinden und
Zeit und Tod vergehen vor lauter Leben.
Mit dem Schluss dieses einzigen Gedichts, das mir über Griechenland zu schreiben bisher vergönnt war, wünsche ich Ihnen, lieber Dionysis Kapsalis, Glück.
Ihr
Mirko Bonné