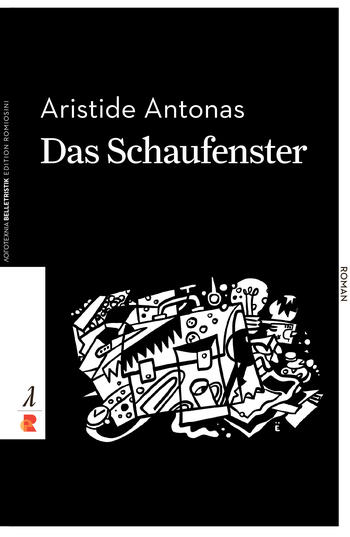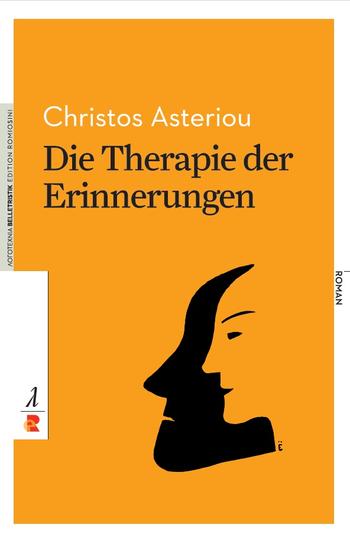#Lesestoff
15.11.2023
Antonas, Das Schaufenster
Bildquelle: Edition Romiosini
Asteriou, Die Therapie der Erinnerungen
Bildquelle: Edition Romiosini
Schriftsteller in Lebens- und Schaffenskrise, Migration, Identitätsbetrug, kafkaeske Verbrechen, abstrakte Bedrohungen, Traumwelten. Die Edition Romiosini hat auf der Frankfurter Buchmesse die neuesten Romane von Aristides Antonas Das Schaufenster in der Übersetzung von Maria Zafón und Die Therapie der Erinnerungen von Christos Asteriou in der Übersetzung von Doris Wille und Sigrid Willer veröffentlicht. Aus den beiden Romanen bieten wir Ihnen zwei Auszüge an.
Η Edition Romiosini εξέδωσε τα πρόσφατα μυθιστορήματα Ο πολτός των πραγμάτων του Αριστείδη Αντονά σε μετάφραση της Maria Zafón και Η θεραπεία των αναμνήσεων του Χρήστου Αστερίου σε μετάφραση των Doris Wille και Sigrid Willer.
Aristide Antonas, Das Schaufenster
Erster teil:
VORBEREITUNG
1
Lederportemonnaies mit tausendfach befingerten schmutzigen Geldscheinen vergammeln übelriechend in meiner Tasche. Eine regelrechte Kloake, in der Notizen, Formulare und Dinge versinken und verwesen wie tote Mäuse. Münzen, Schlüssel und unbenutzte kaputte Kondome fliegen durcheinander, Bücher bekommen Flecken und Eselsohren, Seiten lösen sich, Schnitzel von Notizzetteln werden zu Staub. Ich ekele mich vor der Tasche. Manchmal ertrage ich es kaum, sie anzusehen oder nur an sie zu denken. Dann überwältigt mich Trauer, ich finde den Zustand der Tasche absolut unerträglich. Dann mache ich sie auf und spucke hinein. Ich spucke in die Tasche. Vielleicht ist noch ein sauberes Blatt Papier da drinnen, mich stört, dass es darin noch ein sauberes Blatt geben könnte, gerade dieses saubere Stück Blatt stört mich noch mehr als die zerknüllten, zerrissenen oder zerfetzten Blätter. Ich spucke hinein, um das saubere Blatt schmutzig zu machen, ich spucke auch, um mich gegen die schmutzige Tasche aufzulehnen. Manchmal öffne ich sie und leere den Inhalt auf den Boden aus. Ich zerknülle und zertrete alles, was herausfällt, zerreiße die Zettel und werfe sie in den Müll.
Ich trage die Tasche immer und überall mit mir herum. Gestern wollte ich sie loswerden, sie wegwerfen. Aber warum ausgerechnet die Tasche? Sollte ich nicht eher den Teppich wegwerfen? Oder den Vorhang? Den scheußlichen Sessel? Oder die Lampe? Jetzt kommt mir die Lampe in den Sinn und ich betrachte sie. Sie ist an. Sie blendet mich. Lieber ohne Licht, scheint mir. Ich müsste sie dringend ausschalten. Aber mir fehlt die Kraft, meine Hand hochzuheben, um den Lichtschalter zu betätigen. So viel Wut, so viel Rebellion gegen die Welt der Tasche und der Dinge, und ich habe nicht einmal die Kraft, eine Lampe auszuschalten! Lieber im Dunkeln, ich wäre lieber im Dunkeln, denke ich, aber ich kann mich nicht vom Fleck rühren. Es geht einfach nicht. O Gott, was bin ich nur so schlapp! Wenn es jetzt wenigstens draußen dunkel wäre, so wie es in mir stets dunkel ist. Aber keine Macht der Welt hilft, dass es dunkel wird. Ich glaube, das Dunkel in mir ist endgültig und unwiderruflich. Das Licht draußen, das mir zu erkennen ermöglicht (wie gerade das Licht der Lampe), enttäuscht nur. Das Licht beleuchtet Dinge: zum Beispiel solche, die in die Tasche passen, und andere, die nicht in die Tasche hineinpassen. Wenn die Glühbirne doch nur von selbst durchbrennen würde; sie könnte gerade jetzt durchbrennen, in dem Moment, in dem ich mir wünsche, dass sie aus wäre. Was wäre das für ein Glück! Wenn die Glühbirne jetzt durchbrennen könnte! Dunkelheit ist die verlorene Ordnung des Universums. Dunkelheit zieht mich an wie ein fröhliches schwarzes Loch. Ich sehe Dinge, aber ich will es nicht: Ich will sie nicht sehen. Die verfluchte Glühbirne ist schuld, dass die Dinge da sind. Sie macht sie sichtbar und zudem blendet sie mich. Ich weiß nicht, warum ich so eine helle Glühbirne gekauft habe. Ich muss weg, ich muss raus. Aber auch draußen in der Stadt gibt es eine Beleuchtung: die Nachtbeleuchtung: Ampeln und Laternen beleuchten Dinge, Gebäude und Autos etwa, die ebenso hassenswert sind wie die von dieser Lampe beschienenen. Ich schaue nach oben. Die Lampe steht auf dem Tisch, der Raum darüber ist dunkler. Wenn ich nach oben schaue, kann ich durchatmen und werde ruhiger – falls ich es so nennen kann. Ich ziehe die Zimmerdecke dem Fußboden vor. Dort hängt zwar noch eine Lampe, aber die ist – glücklicherweise – schon lange kaputt. Die Zimmerdecke ist ruhiger als der Fußboden, unbedingt. Die Zimmerdecke lässt keine Dinge zu. Sie ist leer, Dinge fallen stets hinunter auf den Boden, nach unten. Der Boden ist dazu verdammt, der Ort der Dinge zu sein. Deshalb hasse ich den Boden, die Erde und die horizontalen Ebenen, auf die wir fallen: wir und die Dinge. So sehr ich den Altar hasse, so sehr liebe ich die flachen Decken einiger Kirchen. Wenn ich kopfunter an der Zimmerdecke entlanggehen könnte, nur ich (innerhalb des gegenwärtigen Gravitationssystems – also ohne die Dinge), wie die Fliegen und Mücken, wenn ich also nur auf die Füße schauen müsste (der Blick fällt ja meistens auf die Füße), wäre ich ruhiger. Ich wäre von dem Anblick der Dinge befreit, die mich so stören. Oder wenn ich fliegen könnte, wenn ich flöge, dann wäre ich auch ruhiger, von den Dingen befreit, und sicherlich noch erleichterter ohne Dinge, die mir gehören. Dinge, die mir gehören oder gehören könnten, regen mich am meisten auf. Die bringen mich ganz durcheinander. Das Problem ist, dass uns alles gehören könnte. Es heißt, dass die Welt aus Dingen besteht und dass sie die Realität ausmachen, aber Dinge sind nur das, was wir haben oder was wir haben könnten. Wir haben die Dinge geerbt, und zwar so, als hätten wir einen Fluch akzeptiert. Die Dinge sind die Erbsünde.
Die Decke im großen Zimmer hat diesen wunderbaren cremeweißen Farbton. Sie hat diese erstaunlichen Balken, die als bequeme Sitzgelegenheiten dienen könnten, wenn ich an der Decke entlang gehen könnte. Und die kaputte Lampe sähe wie eine umgekehrte schöne Blume aus.
Das Licht könnte dann eingeschaltet bleiben. Der Traum, die Welt auf den Kopf zu stellen, ist vergeblich. Ich gehe lieber kurz etwas frische Luft schnappen. Hoffentlich regnet es auch etwas. Hoffentlich läuft niemand auf der Straße herum. Ich muss mich jetzt aufraffen, um hinauszukommen. Ich habe Gedächtnislücken. Ja, ich bin zu erschöpft, die Hand zu heben, um das Licht auszuschalten, aber wie lange sitze ich schon hier und starre die Lampe an? Vielleicht eine Stunde, vielleicht länger. In einem Zustand von Gleichgültigkeit und Untätigkeit kann man die Zeit nicht messen. Ich kann eine Minute oder vier Stunden gleichmütig und untätig sein, die Zeit setzt aus, danach kann ich nicht erklären, was der Unterschied zwischen vorher und nachher ist. Aus diesem Grund ist Gott gleichgültig und untätig. Er ist zeitlos, denn für Gott gibt es nichts Neues. Ich finde Gottes Einstellung beneidenswert. Gleichgültigkeit entsteht aus einer gewissen positiven Langeweile. Ich würde gerne Gott gleichen. Das gebe ich zu, und ich glaube, dass ich schon fast so weit bin. Jetzt ist die Lampe auf einmal aus, und ich erschrecke darüber, weil ich sie weder ausgeschaltet habe noch habe ich bemerkt, wie sie ausgegangen oder durchgebrannt ist. Nach welchem unklaren Zeitraum stelle ich fest, dass die Lampe aus ist? Das passiert mir häufig, und da, schon wieder. Die Zeit vergeht, ohne dass ich sie kontrollieren kann. Ich konzentriere mich aufs Denken, und wenn ich aus meinen Gedanken auftauche und ins Zimmer zurückkehre (als würde ich aus einer Narkose erwachen), wirke ich wie ein Toter, der auferstanden ist, alles ist anders bzw. etwas ist seltsam: Ich sehe plötzlich, dass die Lampe aus ist. Habe ich sie mit reiner Willenskraft ausgeschaltet? Eher nicht. Ich habe sie wohl eher ausgeschaltet, ohne mich jetzt daran erinnern zu können bzw. ohne es in der Erinnerung festgehalten zu haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Lampe ausgegangen ist. Ich habe sie nicht ausgeschaltet. Ich sehe sie jetzt in ausgeschaltetem Zustand, als hätte ich sie immer so gesehen. Ich schaue nicht auf die Lampe, sondern in Richtung der Lampe. Die Lampe selbst kann man nicht sehen. Und trotzdem hat mich eben noch das Licht gestört. Ich hatte deshalb an etwas gedacht. Oder war es vielleicht bereits die Erinnerung an das Licht, die mich gestört hat? Das Ergebnis meiner Handlung liegt vor mir, aber ich kann mich nicht erinnern, sie ausgeführt zu haben: Folglich habe ich sie nicht ausgeschaltet. Kurz gesagt: Ich habe es zugleich getan und nicht getan. Ich habe die Lampe ausgeschaltet und ich habe sie nicht ausgeschaltet.
Die Lampe ist ausgeschaltet, ich sehe nur das an- und ausgehende Licht unten am Türspalt, wenn jemand im Gebäude den Flur entlanggeht. Meine Augen haben sich nicht nur an das Licht gewöhnt, wenn es unten am Türspalt hindurchscheint, sondern auch an die Lücken in der tiefen Dunkelheit, wenn niemand den Flur entlanggeht; es gelingt mir auch dann, Dinge im Zimmer zu unterscheiden, und sogar gut. So gut, dass ich es müde werde, genau dasselbe zu sehen und zu denken, was ich schon beim Licht der Lampe gedacht habe (dass mir nämlich die leere Zimmerdecke lieber ist – ich schaue zur Decke – und dass ich dort kopfunter herumspazieren könnte und mich nicht mit den heruntergefallenen Dingen auseinandersetzen müsste, die mich ermüden, und so weiter). Bei Licht oder bei Dunkelheit, Lampe an oder aus, letztlich macht es keinen Unterschied fürs Denken.
2
Ich gehe die Treppenstufen hinunter, sehe einen Zigarettenstummel (das Licht ist an) und vielleicht sehe ich auch ein totes Insekt. Ich halte - was wohl? - die Tasche in meiner Hand. Ich gehe hinaus, es ist heiß. Natürlich hat es nicht geregnet, und es herrscht auch keine Ruhe. Obwohl es bereits so spät ist, treiben sich Leute wie ich in der Stadt herum. Das ist unangenehm; mich stören nicht so sehr die Menschen an sich. Es würde mich nicht einmal stören, wenn sie nackt herumliefen. Was mich stört, ist das, was sie bei sich tragen. Ich habe nichts gegen Menschen, aber sie sind - größtenteils - für die Dinge verantwortlich, die sie bei sich tragen. Daran gibt es keinen Zweifel. Wenn ich den Dingen einen Schlag versetzen wollte, müsste ich zuerst die Menschen schlagen. Ihre Tüten, Taschen, Kleider, ihren Schmuck und ihre Uhren stören mich: ihre Dinge, die durch einen Fehltritt plötzlich meine Dinge werden könnten. Sie bedrohen mich auch. Und erst die Taschen! Die sind sicher genau wie meine eigene Tasche: äußerst hassenswerte, scheußliche, schmutzige Taschen. Vielleicht sind sie aber auch aufgeräumt und sauber! Die hasse ich noch mehr. Solche Taschen würde ich am liebsten mit einem Messer aufschlitzen und alle Zettel und Taschentücher darin zerfetzen. Normale Taschen sind ja nicht nur zukünftige schmutzige Taschen, sondern sie verhöhnen meine eigene schmutzige Tasche. Sie machen sich im Grunde genommen über mich lustig und darüber, wie ich mit meiner Tasche umgehe.
In den von nicht sichtbaren Menschen gelenkten Autos sind ebenfalls Taschen, und in den Autos, die die Bürgersteige zugeparkt haben, sind auch Taschen in den abgeschlossenen Kofferräumen verborgen: Ich kann mich nicht gegen sie wehren, ich fühle mich schwach, vielleicht könnte ich ja ein Feuer legen und so viele Autos wie möglich abbrennen, so dicht an dicht, wie sie nebeneinander geparkt sind, und so könnte ich auch alle verborgenen Taschen in den Autos gleich mitverbrennen. Ein paar Autos fahren auf der Straße umher (als wäre das einfach und praktisch), und die sind noch gefährlicher und abstoßender. Ob ich herumlaufe oder stehenbleibe, macht keinen Unterschied, es ist egal. Jetzt geht es mir schon wieder wie vorhin, als ich verwirrt im Zimmer saß und mich gefragt habe, ob die Glühbirne von selbst durchgebrannt ist oder von mir ausgemacht worden ist. Genauso laufe ich jetzt, von den Dingen der Menschen und Autos verwirrt, in der Stadt umher. Ich habe vergessen, seit wann so ich herumlaufe, ich habe vergessen, wohin ich gehe und wo ich überhaupt bin. Autos, Bänke, Bordsteine, Mülltonnen, Taschen. Mit all diesen Dingen konfrontiert, leide ich: Ich leide definitiv, aber ich weiß noch nicht, woran. Vielleicht leide ich an einer Art Weigerung, mich auf irgendetwas davon einzulassen. Ich leide an der Weigerung, irgendetwas davon zu verstehen. Schenke ich den Dingen zu wenig Aufmerksamkeit? Eher im Gegenteil. Ich schenke ihnen zu viel Aufmerksamkeit. Überschüssige Energie, die ich allem zuschreibe? Eher das Gegenteil. Ich sterbe wegen der Dinge, sie sind mein Ende, mein Scheitern. Die Energieverschwendung durch übermäßige Aufmerksamkeit für sie hat mich umgebracht. Ich bin bereits tot und weiß es auch. Ich habe meine Energie verschwendet und hänge in der Luft. Ich konnte der Bulimie der Dinge nicht widerstehen. Meine Konzentration auf die Dinge war ihre Kehrseite. Es geschieht etwas Unglaubliches: Die Reizüberflutung frisst so viel Energie, die ich eigentlich bräuchte, um mich konzentrieren zu können, dass derselbe Energieaufwand schließlich dazu führt, dass ich die Konzentrationsfähigkeit verliere. Ich werde ständig dazu verleitet, meine Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, ich kann dem nicht aus dem Weg gehen, es passiert allerdings, dass ich sie von einem Punkt auf einen anderen lenke, ohne dass es mir jemals gelingt, nachlässiger in punkto Aufmerksamkeit zu werden! Ich kann nicht aufhören, auf etwas konzentriert zu sein. Kann das überhaupt irgendjemand? Leider gibt es immer etwas, auf das man die Aufmerksamkeit richten muss. Mit Aufmerksamkeit und Präzision werde ich abgelenkt: Indem ich meine Aufmerksamkeit von einem Gegenstand zum nächsten lenke, verliere ich mich, während ich zugleich die ganze Zeit absolut konzentriert auf etwas bin. Ich verliere die Orientierung, weil ich zu orientiert bin. Ich frage mich, wie ich meine Aufmerksamkeit von einer Sache auf eine andere lenken kann. Ich ändere nie den Blickwinkel, ich sehe immer nur ein und dieselbe Sache vor mir, und trotzdem verändert sich etwas. Wie also geht das genau vonstatten? Sicherlich tritt nichts Neues in mein Gesichtsfeld hinein. Nichts lenkt mich ab. Meine Gedanken schweifen nicht ab. Nein, im Gegenteil, die Gedanken fließen immer weiter, wie ein Fluss, der nicht eingedämmt werden kann. Sie fokussieren sich immer auf einen Punkt, der rund um die Uhr beschienen wird, und das heißt: in absoluter Konzentration. Nun, wie die Aufmerksamkeit von einem Thema zum anderen gelenkt wird: Ich beantworte das lieber nicht, damit ich keinen Unsinn rede. Ich habe keine Ahnung, wie das vor sich geht. Vielleicht gibt es nicht einmal die Möglichkeit, dass die Gedanken von einem Thema zum anderen übergehen. Vielleicht beschäftigen sich die Gedanken mit nichts anderem außer mit den Gedanken selbst. Sollen die Gedanken doch denken, dass sie mit etwas beschäftigt seien. In Wirklichkeit, also dort, wo wir glauben, dass es Gedanken über etwas gibt, gibt es folglich ausschließlich Konzentration. Vielleicht reicht das Objekt der Aufmerksamkeit niemals aus, um etwas außerhalb der Aufmerksamkeit geschehen zu lassen.
Aus dem Griechischen übersetzt von Maria Zafón
Christos Asteriou, Die Therapie der Erinnerungen
Erster Teil:
Chronik eines Absturzes
Im Oktober 2015 passierte es: Die Veranstaltung, die Barry Epstein zu meinen Ehren organisiert hatte, endete für mich in einem Desaster. Ich hatte meine Teilnahme zugesagt, dabei war mir klar gewesen, dass es nicht gut ausgehen würde. Der Verlauf des Abends bestätigte meine schlimmsten Befürchtungen, denn wenige Minuten vor Schluss brach ich zusammen und schlug vor den Augen des Publikums der Länge nach hin. Alle im Saal, die später erfuhren, wie es um mich stand, waren der Meinung, ich hätte Barrys Einladung ablehnen müssen. Ich hätte überhaupt nicht bei der Lesereihe Mit einem Glas Wein erscheinen dürfen, die unter seiner Leitung in der Musikakademie Brooklyn stattfand. Sie hatten vollkommen Recht. Obwohl ich selbst gern ein Glas zu viel trank, konnte ich der Vorstellung von ein paar Dutzend Leuten, die kalifornischen Cabernet über ihren Gaumen gleiten ließen, während ich mich bemühte, ihnen etwas vorzulesen, ganz und gar nichts abgewinnen. Doch ich schätzte Barry sehr und gab seinem Drängen nach, ohne lange zu überlegen. Wer meinen Werdegang als Schriftsteller nicht kennt, dem wird auch entgangen sein, wie dankbar ich Barry aus einer ganzen Reihe von Gründen bin. Zunächst einmal für eine wunderbare Rezension meines ersten Buches, als ich nach einer gescheiterten Karriere als Comedian beschlossen hatte, mich der Literatur zuzuwenden, während er, zehn Jahre älter, eine eigene Kolumne in der Samstagsausgabe der Times hatte. Mein kleiner Erzählband war bei einem zweitklassigen Verlag erschienen, ohne besondere Resonanz zu finden, bis ihn der Bücherwurm Epstein im Rainbow aufstöberte, einem Kellerloch in East Village voller gebrauchter Bücher und Titel von unabhängigen Verlagen. Es dauerte nicht lange, bis die Fangemeinde seiner Kolumne nach dem schmalbrüstigen Band verlangte, der bald darauf auf den Verkaufstheken im Strand Bookstore auslag und in einem Zeitraum von wenigen Monaten drei Neuauflagen erzielte.
Ich hatte das Glück, Barry ein paar Monate später bei einem Vortragsabend zum Thema Schelmenroman persönlich kennenzulernen. Da ich wusste, dass er der Hauptredner sein würde, hatte ich dafür gesorgt, mich dort einzufinden. Ich hatte mich ins Publikum gesetzt und war seinen Ausführungen gefolgt, bevor ich den Mut aufbrachte, ihn anzusprechen und ihm für seine Besprechung zu danken. Er schien mir ein hervorragender Gesprächspartner zu sein, wenn ich auch bei dieser Einschätzung zweifellos von seiner positiven Meinung über mein Buch beeinflusst war. Ich fragte Barry, wie es genau in seine Hände gelangt sei und warum er sich entschlossen habe, darüber zu schreiben. Er erzählte mir von seiner Gewohnheit, Stunden in unabhängigen Buchhandlungen zu verbringen und sich zunächst anzuhören, was ihm vertrauenswürdige Verkäufer empfahlen, bevor er sich zu einem Kauf entschloss. Er erwähnte auch Terry Kozinski, der auf Studien zum Zweiten Weltkrieg versessen war – zufällig kannte ich ihn auch und kann bestätigen, dass er tatsächlich dazu in der Lage war, aus dem Stand ein Dutzend Generäle mit Geburts– und Sterbedaten aufzuzählen. Ein paar Jahre später stellte Barry mir bei einem gemeinsamen Spaziergang Matt Espozito vor, einen Buchhändler, der in jeder Lebenslage eine Buchüberraschung aus Lateinamerika als Ass im Ärmel hatte. Barry hatte über die Jahre eine Stichprobenmethode entwickelt. Danach war ein Roman, der ihn neugierig machte, höchstwahrscheinlich ein gutes Buch, selbst wenn er nur ein paar Reihen in zufälliger Abfolge gelesen hatte, – er benutzte stets das Wort »Reihen« statt »Zeilen« oder »Auszug«. Als passionierter Literaturliebhaber nutzte er seine sämtlichen Geschäftsreisen dazu, um zwischendurch in den kuriosesten Buchläden der Vereinigten Staaten zu verschwinden und die Verkaufstheken zu durchwühlen wie ein Goldgräber den eisigen Schlamm auf der Suche nach Nuggets.
Als ich Barry anrief, um meine Teilnahme an der Veranstaltung zu bestätigen, erinnerte ich ihn an diese erste Rezension. Damit bot ich ihm einen guten Anlass, über die vergangenen Jahre zu sprechen, »schöne Jahre«, wie er mir sagte, Jahre, die ausgefüllt waren mit Schreiben, persönlichen Erlebnissen und den wenigen notwendigen Pausen zwischen zwei Büchern. Stets bewunderte ich seine Art, einen nostalgischen Schleier über die Dinge zu breiten, selbst wenn er über jüngste Ereignisse sprach, und seine Fähigkeit, auf einzigartige Weise die Vergangenheit wiederaufleben zu lassen und noch den trivialsten Episoden Tiefe zu verleihen. Er erzählte mir mit jugendlicher Begeisterung von der Lesereihe in der Akademie, als wäre sie das wichtigste Vorhaben in seinem Erwachsenenleben, und nachdem wir ein paar Details zum Ablauf vereinbart hatten, ließ ich ihn am anderen Ende der Leitung über alte Zeiten reden.
Zuletzt hatte ich ihn auf einem Ökomarkt getroffen, wo er unbeschwert zwischen den Ständen umherschlenderte. Wir grüßten uns von Weitem und gingen weiter, ohne jedoch miteinander zu sprechen. Vorausgegangen war ein anderes Treffen am Eingang zum Restaurant Knickerbocker, wo wir ins Gespräch gekommen waren, während wir, jeder mit seinen Freunden, darauf warteten, einen Tisch angewiesen zu bekommen. In der Zeit vor seinem Anruf hatten unsere Kontakte deutlich nachgelassen, aber ich kann nicht sagen, dass mich diese zunehmende Distanzierung befremdete. Ich hatte auch schon früher andere mir liebe Menschen aus den Augen verloren, bis ich dann einige Zeit später wieder mit ihnen zusammenkam. Was ich nicht so leicht wegstecken konnte, war eine Reihe von Ereignissen, die unser Leben zum Schlechteren hin verändert hatten. Erst im vergangenen März war Barrys Frau Margarita unerwartet im Schlaf gestorben. Wenige Monate später wurde bei ihm Prostatakrebs festgestellt. Zum Teufel noch mal, fragte ich mich, wie kann das sein? »Die OP ist hervorragend verlaufen«, begann er in gespielt unbekümmerten Tonfall, während ich durch den Hörer mitbekam, wie er auf dem Mundstück einer elektronischen Zigarette herumkaute. Die unblutige Operation mit der Robotertechnik, die sein Arzt angewandt hatte, war offenbar ausgesprochen gut verlaufen. »Kleine Schnitte, kaum Blutverlust, und abgesehen davon konnte ich am nächsten Tag schon nach Hause. Es war viel einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte«, schloss er im Ton eines Nachrichtensprechers, »und abgesehen von ein paar unbedeutenden kleinen Komplikationen, lief alles wie am Schnürchen.« Wer’s glaubt …, dachte ich mir, ich kenne ihn besser als er meint! Obwohl er versuchte, so zu tun, sei das Schlimmste überwunden, verriet ihn seine brüchige Stimme nur allzu deutlich. Das Theater dauerte nicht lange, denn nach und nach wurde er von seinen Gefühlen übermannt und vertraute sich mir an. Bevor ich fragen konnte, wie all das passiert war, fing Barry schon an, die Ereignisse der letzten Monate zu beschreiben.
»Als ich von meinem Morgenspaziergang zurückkam, sah ich sie im Bett liegen. Ich stellte die Einkäufe in der Küche ab und erzählte das übliche Alltagszeug, bekam aber keine Antwort. Es war nicht das erste Mal, dass ich Flöhe husten hörte, aber diesmal sagte mir mein Gefühl, dass wirklich etwas nicht in Ordnung war. Ich blieb im Zimmer stehen, um zu hören, ob sie atmete. Mein Blick fiel auf eine gemusterte Bluse und ein Paar noch ungetragene Gesundheitsschuhe hinter der Schranktür. Als ich schließlich der Wahrheit ins Auge blicken musste, war ich unfähig, etwas zu tun – ich war wie gelähmt. Wie ein Idiot stand ich am Fenster und betrachtete den Verkehr. Ich spülte das Geschirr, als wäre alles wie immer. Danach rief ich die Polizei, es kamen zwei junge Kerle für die Formalitäten, ich musste ein paar Papiere unterschreiben, und dann nahmen sie sie mit.
Ein paar Monate hielt ich es dort noch aus und zog dann weg, ohne lange darüber nachzudenken. Du kannst dir nicht vorstellen, mein Lieber, wie schwer es ist, in diesem Alter seine Gewohnheiten zu ändern, wenn man plötzlich wieder allein leben muss. Denk nicht, dass ich alles mitgenommen habe; aus dem alten Haus habe ich kaum etwas behalten. Nur das, was ich brauchte, um mich an ein paar glückliche Momente zu erinnern, sonst nichts.«
Ich hörte mir an, was Barry zu berichten hatte, und war überzeugt, dass er schuftete wie ein Pferd, um darüber hinwegzukommen, dass seine Frau nicht mehr da war. Seine Prostata war ihm völlig egal. Margaritas Platz im Bett würde für immer leer bleiben. Es fiel mir nicht sonderlich schwer, mich in ihn einzufühlen, wenn ich es damals auch mit einer anderen Art von Tod zu tun hatte. Ich war gerade dabei, die Kontrolle über eine Reihe von Angelegenheiten zu verlieren – alles, von dem ich bisher geglaubt hatte, dass es mein Leben ausmachte, glitt mir durch die Finger. Ich war mir nicht sicher, ob Epstein meine Lage kannte, als er wie ein weiteres Gespenst aus der Vergangenheit auftauchte, hatte aber keinen Grund, etwas anderes anzunehmen. Unter uns Schreiberlingen bleibt ja nichts geheim. Über Laura weiß er bestimmt Bescheid, dachte ich – unsere Trennung war niemandem verborgen geblieben. Vielleicht hatte er auch von meiner Festnahme erfahren, als ich in betrunkenem Zustand auf der Sixth Avenue angehalten wurde und die Nachricht, Gott weiß wie, Freunden und Kollegen zu Ohren gekommen war. Möglich, dass er von Leuten, die ich nicht einmal kannte, Gerüchte über mich gehört hatte. Ich konnte es zwar nicht wissen, fragte aber auch nicht nach. Ohnehin war das Wichtigste in diesem Fall, dass Barry überhaupt angerufen hatte.
Ich habe mich oft gefragt, was wohl meine alten Nachtclub–Freunde von meinem desolaten Privatleben gehalten hätten, damals, als ich noch geduldig an der Bar ausharrte, um die Show für eine Handvoll Zuschauer mit ein paar schlüpfrigen Witzen zu beenden. Oder auch die Leser meiner Bücher in Erfolgszeiten, zumindest diejenigen, die sich ein Bild von mir als unterhaltsamem Autor machten, eines Mannes mit Humor ohne sonstige Eigenschaften. Einige wären sicher überrascht gewesen. Andere wiederum würden vielleicht sogar verstehen, wie ich mich fühlte, während ich mit Riesenschritten auf die sechzig zuging und unfähig war, mit bestimmten Situationen fertig zu werden, die ich einige Jahre früher mit meiner gewohnten Nonchalance gemeistert hätte. Es mag paradox klingen für jemanden, der sich auf Komödien verlegt hatte, aber ich glaubte wirklich, ich stünde kurz vor dem Zusammenbruch. Obendrein konnte ich den weiteren Entwicklungen auch nichts Komisches abgewinnen. Mit Grauen beobachtete ich meinen körperlichen Verfall, während ich schon seit langem aufgehört hatte zu schreiben. Einige Male versuchte ich einen Wiedereinstieg mit einem neuen Roman, doch meine sprichwörtliche Leichtigkeit, mit der ich Geschichten aus dem Ärmel schütteln konnte, war nur noch eine ferne Erinnerung. Monatelang quälte ich mich auf jede erdenkliche Weise damit herum. Variationen desselben Themas, Erzählungen in der ersten und in der dritten Person, unterschiedliche Blickwinkel, ein Anlauf nach dem anderen, alles vergeblich. Mir waren die Kräfte ausgegangen und abgesehen von einigen momentanen Geistesblitzen, die wie ein billiges Feuerwerk verloschen, war an mir nichts Lustiges mehr zu finden. Nur wenn ich gelegentlich mit meinen Lesern zusammentraf, beeilte ich mich, ihnen zu versichern, ich sei fieberhaft an einem Text dran, und ließ sie glauben, was sie wollten.
Plötzlich befand ich mich in einem Vakuum, in dem alles von Grund auf neu gedacht werden musste. Die Tage vergingen mit strenger, ewig gleicher Routine. Ich hatte damals schon systematisch mit dem Trinken angefangen. Bis zum Morgengrauen mühte sich meine Leber damit ab, den Alkohol des Vorabends abzubauen. Nach meiner Morgentoilette zog ich mich an, ging in die Stadt und nahm dabei immer die gleiche Strecke. Im Grunde brauchte ich diese Regelmäßigkeit, Dinge, an die ich mich halten konnte; mein Leben verlangte nach Stabilität. Als ich jung war, hatte ich noch dieses naive Gefühl von Unendlichkeit und glaubte, ich würde ständig neue Erfahrungen machen. Mit zunehmendem Alter übermannte mich das, was ich den »Schrecken des letzten Mals« getauft hatte. Wenn ich mich von Freunden verabschiedete, quälte mich der Gedanke, dass wir uns vielleicht nie wiedersehen würden. Ich verließ Orte in dem Glauben, dass ich nie wieder zurückkehren würde. Schwanengesänge hallten mir auch bei den unwichtigsten Tätigkeiten in den Ohren. Ein Gefühl der Vergänglichkeit bestimmte mein Tun. So sehr ich mich auch vorsah, wäre ich doch stets unvorbereitet auf das, was geschehen sollte; immerhin erleichterte mich das Gefühl, ständig auf der Hut zu sein.
Bis ich von meinem Spaziergang zurück war, hatte meine Haushaltshilfe die Wohnung in Ordnung gebracht. Meine Hemden hingen gebügelt im Schlafzimmer, die Betten waren frisch bezogen und dufteten nach Weichspüler. Wenn sie mit der Hausarbeit fertig war, begann die nachmittägliche Ruhe allmählich den Raum zu überfluten wie eine träge Brandungswelle in Zeitlupe. Nachdem ich sie zur Tür gebracht und mit ihr unseren nächsten Termin vereinbart hatte, machte ich es mir auf dem Sofa bequem. Doch ich konnte mich von den Geistern der Vergangenheit nicht befreien. Ich versuchte, mich mit der Zubereitung einer schnellen Mahlzeit abzulenken, aber Lauras Bild tauchte immer wieder auf und spukte in meinem Kopf herum. Von unserem gemeinsamen Leben rief ich mir besonders unser letztes Abendessen auf der Veranda in Erinnerung, um immer aufs Neue ihrem starren Blick standzuhalten, mit dem sie die Trennung verlangte. In meinen Träumen sah ich viele verschiedene Varianten jenes Abends. Bis zum frühen Morgen führte ich einen Schattenkampf mit ihrem Gespenst, und, wie zu erwarten, war ich stets der Verlierer.
Bei unserem wöchentlichen Termin sprach ich mit Dr. Baker über all die Fragen, die mich beschäftigten. Nach mehreren stundenlangen Sitzungen, die mich ein Vermögen gekostet hatten, war der erfahrene Arzt zu dem Schluss gekommen, dass ich an »Adaptiven Abwehrmechanismen« litt. Mit anderen Worten befand er, dass ich nicht dazu bereit war, die neue Situation zu akzeptieren, die sich nach unserer endgültigen Trennung ergeben hatte. Seiner wissenschaftlichen Ansicht nach blieb ich der Vergangenheit verhaftet, und er hielt eine weitere Reihe von Sitzungen für unabdingbar, damit die Wunde heilte. »Ich hoffe, Sie verstehen das«, murmelte er, wobei er hin und wieder etwas auf einem kleinen Block notierte. Natürlich verstand ich es. Andererseits war es nicht nur die Trennung als solche, die ich zu begreifen versuchte, sondern hauptsächlich der Moment, den Laura gewählt hatte, um mich zu verlassen. Anlässlich einer heftigen Auseinandersetzung einige Wochen zuvor hatte ich sie erfolglos zu überzeugen versucht, dass wir einen Neuanfang verdient hätten. Der Grund für mein Scheitern war offensichtlich: Je mehr ich sie darum bat, dass wir wieder zusammenfinden, desto mehr bestand sie auf ihrem Bohème–Trip und sprengte alle emotionalen Brücken, die uns verbanden. Erst vor Kurzem hatte sie eine Reihe neuer alternativer Lebensphilosophien entdeckt, die sie vollkommen in Anspruch nahmen; zusammen mit Yoga führten auch Rohkostnahrung und Meditation Laura auf einen neuen Weg zur Selbsterkenntnis, so behauptete sie. Es gab kein Zurück. Sie nahm das Nötigste für die erste Zeit mit, zog vorübergehend zu ihrer besten Freundin und von da aus packte sie ihre Sachen und mietete sich eine kleine Wohnung ganz in der Nähe ihres Ateliers.
Dr. Baker hatte einen Plan für mich, um aus der Krise zu kommen, den er mir eingehend erläuterte. »Sie müssen Ihre Fehler akzeptieren«, sagte er bedeutungsschwanger und fuhr mit dem Zeigefinger die lange Liste seiner Notizen entlang. Der ganze Prozess würde sich hinziehen. »Sie haben sich über lange Zeit systematisch von Laura entfernt, das müssen Sie sich klarmachen. Sie hat nicht aus einer momentanen Laune heraus reagiert; es war vielmehr das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung in die falsche Richtung. Sie müssen außerdem darauf vorbereitet sein, dass Laura mit einem neuen Partner auftaucht; unter uns gesagt, halte ich das für äußerst wahrscheinlich. Gewöhnen Sie sich erst einmal an den Gedanken, dass Sie nicht mehr zusammenleben. Und bleiben Sie unbedingt auf Abstand, bis Sie wieder einigermaßen im Gleichgewicht sind …« Ich nickte zustimmend, aber in den Nächten rief ich sie, vom Alkohol benebelt, auf dem Handy an. Ich bestand darauf, dass es einen neuen Versuch wert wäre, verlangte von ihr, noch einmal mit mir von vorn anzufangen. Bis mein wirres Lallen schließlich immer schwächer wurde. Die erste Enttäuschung begann nach und nach abzuflauen und verwandelte sich in Trauer über die Verluste, die sich auftürmten.
Meine Probleme vervielfachten sich inzwischen geradezu exponentiell. Obwohl ich früher zum Bespiel nur zu gesellschaftlichen Anlässen trank, wurde ich nun immer stärker vom Alkohol abhängig – sei es, um meine verlorene innere Balance wiederherzustellen, sei es, um ganz bewusst die Kontrolle zu verlieren. Ich wurde Stammgast in einem irischen Pub mit fantastischer Aussicht auf den East River und einem der besten Tresen der Gegend. Der ideale Ort, um mit allen möglichen Typen ins Gespräch zu kommen und über Gott und die Welt zu palavern. Ich liebte die Atmosphäre, das undefinierbare Zusammengehörigkeitsgefühl von Menschen, die sich nicht kannten. Der Alkohol lockerte die Körper und löste die Zungen, der Abstand zwischen uns verringerte sich. Ich hatte dort eine ganze Reihe faszinierender Leute kennengelernt. Mary Sorvino zum Beispiel, fünfundsechzig Jahre und ein echter Paradiesvogel mit ihren teuren Kleidern und dem Kamelhaarmantel. Ihr müder Leib verströmte einen Hauch von verblühter Sexualität und versprach mehr, als er zu halten in der Lage war. Ich genoss es, neben ihr auf dem Hocker zu sitzen, ihr die Komplimente zuzuflüstern, die sie so liebte, und sie im Morgengrauen betrunken ins Taxi zu verfrachten. Oder Martin Clark, der jeden Freitag nach der Arbeit kam, um allein zu trinken. Mit seinem alten Nissan durchpflügte er die Gegend auf der Suche nach einem Schnäppchen. »Die Kunden sind nie zufrieden«, beschwerte er sich jedes Mal, und sein Blick verlor sich in der Tiefe des Raumes. »Man kommt nicht zur Ruhe, alles kann sich im letzten Moment noch ändern. Ansonsten ist die Arbeit ganz einfach – billig einkaufen, teuer verkaufen, das ist alles. Ein Maklerjob ist schließlich keine Kernphysik!«, sagte er und trank noch ein Bier. Selten fing er von sich aus ein Gespräch an; er telefonierte lieber mit dem Handy. Viele glaubten, dass es am anderen Ende der Leitung niemanden gab. Martin war, so hieß es, noch so ein Typ, der gegen seine Platzangst ankämpfte.
An seiner Seite erlebte ich zufällig den Horror meiner ersten Panikattacke. Im Auto auf dem Weg in die Bar hatte ich bereits den Kopf voller merkwürdiger Gedanken über die Zukunft gehabt. Um mein Unbehagen zu übergehen, öffnete ich das Fenster, streckte den Kopf leicht nach draußen und ließ mir den eisigen Wind ins Gesicht wehen. Mein Herz begann zu rasen, als wolle es sich dem Tempo des Wagens anpassen. Etwas hatte die Kontrolle über meinen Körper übernommen und drückte aufs Gas, mein Pulsschlag beschleunigte sich, und ich driftete ins Ungewisse ab. Ich betrat die Bar in der Hoffnung, dass es besser würde. Aber ich spürte, wie meine Beine allmählich taub wurden. Das Blut gefror mir in den Adern und kalter Schweiß stand mir auf der Stirn. Ich versuchte, tief durchzuatmen und mir nichts anmerken zu lassen. Die Wände kamen auf mich zu, der Sauerstoff wurde immer knapper in einem klaustrophobischen Crescendo, wie ich es noch nie erlebt hatte. Eine unbestimmte Angst schnürte mir die Kehle zu. Ich legte die Finger an den Hals, um den Herzschlag zu messen, und ehe ich mich versah, lag ich schon auf dem Boden. Eine ganze Zeitlang zitterte ich und fühlte mich wie ein Fisch auf dem Trocknen. Ich dachte, mein Ende sei nahe. Martin behielt die Nerven und rief einen Krankenwagen. In der Zwischenzeit gelang es einem vom Personal, mir ein Beruhigungsmittel in den Mund schieben.
Nach dem ersten Anfall wurden die Krisen häufiger, wenn auch weniger heftig. Der Schrecken lauerte hinter den geschlossenen Türen eines Kinosaals, im engen Gang eines Geschäfts, häufig sogar in meinem eigenen Bett. In ihrer leichten Version ähnelte die Panik einem Schwindelgefühl. Sie hielt ein paar Minuten an, bevor sie in eine einfache Übelkeit überging und dann ganz aufhörte, um einen vom Tremor geschwächten Körper zurückzulassen. Ich beschloss, mich dem Problem zu stellen und entwickelte mithilfe von Dr. Baker bestimmte Techniken. Es kam für mich nicht infrage, mich zuhause einzuigeln, so sehr mich die Vorstellung eines weiteren Zusammenbruchs in aller Öffentlichkeit auch erschreckte. Das war ein weiterer Grund, weswegen ich Epsteins Vorschlag nicht ablehnte, an dieser retrospektiven Veranstaltung zum 25. Jahrestag meines literarischen Debüts teilzunehmen. Ich glaubte, ich hätte bis dahin genug Zeit, um die Dinge ins Lot zu bringen und sogar ein kurzes Stück für den Anlass zu schreiben. Ich sah diesen Abend als eine gute Gelegenheit zu einem Comeback an, aber, wie sich im Nachhinein herausstellte, entbehrte mein übermäßiger Optimismus jeder vernünftigen Grundlage.
Aus dem Griechischen übersetzt von Doris Wille und Sigrid Willer